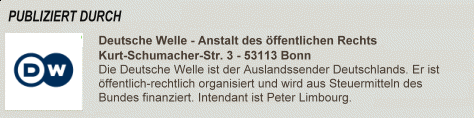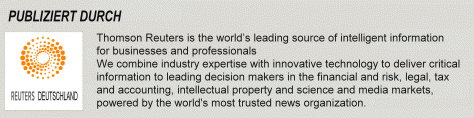(Bildquelle: AFP/Getty Images/C. Lomodong)
Im Südsudan ist der Bürgerkrieg wieder aufgeflammt. Bis zu zwei Millionen Menschen sind auf der Flucht – und Frieden ist nicht in Sicht. Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Katastrophe.
Im ölreichen Norden des Südsudan wird wieder heftig gekämpft. Wer kann, bringt sich in Sicherheit. Auch die meisten Hilfsorganisationen haben den Rückzug angetreten. Damit seien nun rund 500.000 Menschen ohne Hilfe, erklärte diese Woche der UN-Verantwortliche für den Krisenstaat Toby Lanzer. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als die Hälfte der zwölf Millionen Einwohner auf humanitäre Hilfe angewiesen.
Auch das Internationale Rote Kreuz (ICRC) bestätigte, dass die Helfer inzwischen nur einen kleinen Teil der Notleidenden erreichen. Ernteausfälle aufgrund des Krieges verschlimmerten die Lage, die Regenzeit auch. „Eigentlich sollte die Bevölkerung in den vom Krieg betroffenen Gebieten jetzt ihre Felder bestellen. Stattdessen aber sind sie auf der Flucht“, sagte Pawel Krzysiek, ein Mitarbeiter des ICRC in der südsudanesischen Hauptstadt Juba, im Gespräch mit der DW.
Gewalt gegen Kinder
Besonders schwierig sei die Lage der Kinder, deren Familien vor dem Krieg fliehen mussten, betont Krzysiek. „Diese Kinder brauchen Nahrung und eine besondere Gesundheitsversorgung, denn sie sind für bestimmte Krankheiten besonders anfällig.“ Das Internationale Rote Kreuz wisse von 250.000 Jungen und Mädchen, die schwer unternährt seien.
Die Vereinten Nationen prangern außerdem eine neue Welle von Gewalt gegen Kinder an. Dutzende seien in den vergangenen Wochen in dem Bundesstaat Unity von bewaffneten Gruppen gezielt getötet worden, teilte das Kinderhilfswerk Unicef jetzt mit. Weitere Kinder seien vergewaltigt, entführt oder zwangsrekrutiert worden.
Krankenhaus in Gefahr
In der Umgebung der Stadt Kodok nördlich von Malakal unterstützt das Internationale Rote Kreuz ein Krankenhaus. Doch der Betrieb musste aufgrund der heftigen Gefechte in der Umgebung bereits eingeschränkt werden. „Wegen der Kämpfe mussten wir teilweise unser Personal von dort abziehen und in ein sicheres Gebiet ausweichen. Eine dramatische Entwicklung, denn dieses Krankenhaus ist sehr wichtig für die Gesundheitsversorgung der Menschen in der Gegend“.
Circa 600 Patienten würden dort pro Woche behandelt, vor allem Kinder. Das Schlimmste lasse sich nur noch abwenden, wenn der Krieg sofort beendet und die internationale Hilfe massiv aufgestockt werde, sagt Pawel Krzysiek. Er weiß, dass das so schnell nicht passieren wird.
Während die Hilfsorganisationen um Frieden betteln, damit ihre Hilfe die Bevölkerung erreicht, hat Südsudans Regierung im vergangenen Jahr von China Waffen im Wert von 38 Millionen Dollar erhalten – und mit Öl bezahlt.
Schwere Menschenrechtsverletzungen
Bei ihrer Offensive gegen Rebellen hat die südsudanesische Armee nach Einschätzung des um Frieden bemühten regionalen Staatenbunds IGAD schwere Menschenrechtsverletzungen begangen. In einer IGAD-Erklärung ist die Rede von „Gewalt gegen Zivilisten“, „zerstörten Dörfern“ sowie „unentschuldbaren und entsetzlichen Aktionen“. Das aus acht ostafrikanischen Ländern bestehende IGAD-Bündnis verwies darauf, dass die Armee die Ende April im nördlichen Bundesstaat Unity begonnene Offensive mittlerweile auf die Bundesstaaten Jonglei und Upper Nile ausgedehnt habe.
Auch Human Rights Watch (HRW) dokumentierte dutzende Fälle, in denen sowohl Militäreinheiten als auch die nationalen Sicherheitskräfte in den vergangenen Monaten Menschen willkürlich verhaftet, gefoltert und geschlagen haben sollen. „Diese Verhaftungen geschehen fernab von der Weltöffentlichkeit. Denn die Welt schaut vor allem auf die kriegerischen Auseinandersetzungen“, sagt Leslie Lefkow vom HRW-Büro in Abidjan in der Elfenbeinküste. „Unabhängig vom Krieg ist es also notwendig, im Südsudan gesetzliche Reformen einzuführen, um die Macht des Militärs und der Sicherheitskräfte zu kontrollieren.“
Armeesprecher Philip Aguer wies die Vorwürfe zurück. Das Militär handele in „Selbstverteidigung“ und folge einem Verhaltenskodex, der Angriffe auf Zivilisten untersage.
Dramatische Lage seit 2013
Südsudan ist seit 2011 unabhängig. Im Dezember 2013 war der lange schwelende Machtkampf zwischen Präsident Salva Kiir und seinem ehemaligen Stellvertreter Riek Machar eskaliert. Verschärft wird der Konflikt dadurch, dass die beiden Politiker rivalisierenden Volksgruppen angehören. Friedensverhandlungen zwischen den Konfliktparteien scheiterten bislang. Auch Gespräche Anfang März in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba brachten keinen Erfolg. Fast zwei Millionen Menschen sind nach UN-Angaben seit 2013 auf der Flucht.
Auf der nationalen Bühne kämpfen Veteranen des Unabhängigkeitskrieges um die Pfründe des jungen Staates. Beide Seiten wollen vor allem die Ölfelder und damit die einzige Einnahmequelle des Landes unter ihre Kontrolle bringen.