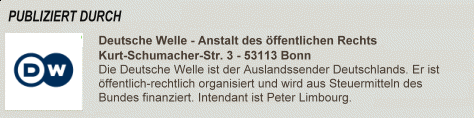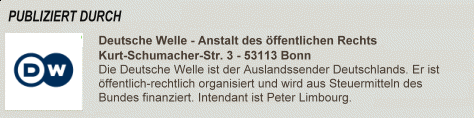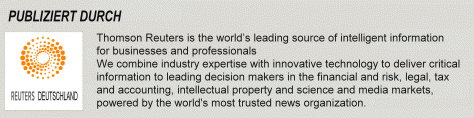(Bildquelle: picture-alliance/Arco Images/K. Kreder)
Wohlstand, Frieden und saubere Luft: In sechs Monaten entscheidet die Welt über neue nachhaltige Entwicklungsziele – die sogenannten SDGs. Wie beurteilen afrikanische Beobachter die Verhandlungen? Wir haben nachgefragt.
Der Tschadsee in Westafrika: ausgetrocknet. Die Böden im Nil-Delta: versalzen. Die Giraffen in Südafrika: tot. Wenn Bakary Kante über Gefahren für seinen Kontinent spricht, redet er sich gerne mal in Rage. Früher hat er im Umweltministerium seiner Heimat Senegal gearbeitet, später für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP). Heute reist er als Politikberater seiner eigenen Nichtregierungsorganisation ASCENT durch Afrika und die Welt und mischt sich ein in die globale Debatte über Nachhaltigkeit. Seine Botschaft an die Entscheider ist deutlich: „Wacht endlich auf, die Zeit rennt uns davon!“
Die afrikanischen Staaten gehören zwar nicht zu den großen CO2-Sündern, aber Wissenschaftler warnen: Der Klimawandel wird auf dem Kontinent so hart zuschlagen wie nirgendwo sonst auf der Welt. „Es muss sich endlich etwas ändern“, predigt Kante. „Unsere Bevölkerungen wachsen, unsere Wirtschaft auch – das hat dramatische Folgen für die Ökosysteme.“ Deshalb beobachtet er zurzeit sehr genau, was die Weltgemeinschaft unternehmen will, um künftig Entwicklung dauerhaft zu fördern – ohne dass Mensch und Umwelt darunter leiden.
Was haben die Millenniumsziele gebracht?
2015 gilt dabei als Schicksalsjahr: Im Dezember soll die internationale Staatengemeinschaft in Paris ein neues Klimaschutzabkommen beschließen. Und drei Monate vorher, Ende September, wollen die Vereinten Nationen die neuen nachhaltigen Entwicklungsziele verabschieden, die Sustainable Development Goals (SDGs). Sie sollen für alle Länder gleichermaßen gelten – für Industriestaaten wie Deutschland genauso wie für Entwicklungsländer, etwa Kamerun oder Äthiopien. Neben dem Kampf gegen Hunger und Armut stehen ertsmals auch Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften im Fokus. Das gesamte Paket soll die bisherigen acht Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs) ablösen.
2015 wird also auch Bilanz gezogen, was die MDGs seit ihrer Verabschiedung vor 15 Jahren gebracht haben. Das Fazit fällt sehr gemischt aus. Während es weltweit vielen Entwicklungsländern gelungen ist, die Anzahl der Menschen in extremer Armut zu halbieren, haben das in Afrika gerade einmal sechs Länder geschafft, zum Beispiel Senegal, Kamerun und Tunesien. Aber in Nigeria, Kenia oder der Zentralafrikanischen Republik hat sich die Lage nach Angaben der Afrikanischen Entwicklungsbank sogar noch verschlechtert.
Und trotzdem: „Die MDGs haben geholfen, mehr Aufmerksamkeit für viele Probleme in Afrika zu schaffen“, sagt Fatan Aggad. Die Südafrikanerin arbeitet für den europäischen Think Tank ECPDM im niederländischen Maastricht. So gingen heute etwa viel mehr Kinder zur Grundschule als noch vor 15 Jahren, nicht nur Jungen – auch Mädchen. Nirgendwo sonst habe sich der Zugang zu Bildung so rasant verbessert wie in Afrika. „Aber jetzt steht der Kontinent vor dem Problem, dass es zwar viele Schulabgänger gibt – die finden allerdings keine Jobs.“ 500 Millionen Menschen drängen laut Schätzungen in den nächsten Jahren auf den afrikanischen Arbeitsmarkt.
Was braucht Afrika?
„Was wir mit den MDGs nicht geschafft haben, das müssen die SDGs jetzt leisten“, sagt Salina Sanou von der Nichtregierungsorganisation ACORD in Nairobi. Der Wunschzettel für die neuen Ziele ist lang. Welche am Ende tatsächlich drauf kommen und welche nicht, darüber verhandeln Diplomaten aus der ganzen Welt seit drei Jahren: Inzwischen liegen nicht weniger als 17 Hauptziele und 169 Unterziele auf dem Tisch. Ziel 1 zum Beispiel lautet: „Armut beenden, in all ihren Formen, überall.“ Oder Ziel 7: „Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie schaffen“. Längst werben aber vor allem Politiker aus Industriestaaten dafür, die Liste deutlich zu kürzen.
Ziel 5 fordert: „Gleichberechtigung der Geschlechter erreichen und die Rechte aller Frauen und Mädchen stärken.“ Salina Sanou hätte sich ein noch stärkeres Bekenntnis gewünscht, denn in vielen afrikanischen Ländern seien Zwangsehen, Missbrauch und Diskriminierung bitterer Alltag. Außerdem vermisst sie ein Ziel zu sozialen Sicherungssystemen. „In westlichen Staaten haben die Menschen Zugang zu guten Ärzten, zu Sozialhilfe, zu Versicherungen“, sagt die Aktivistin. „Bei uns in Afrika gibt es so etwas nicht. Hier sind die Familien das soziale Netz, das den Einzelnen auffangen muss.“
Frieden als Bedingung für nachhaltige Entwicklung
Ziel 16, „Friedliche Gesellschaften fördern“, haben die afrikanischen Staaten eingebracht: „Bis zur letzten Minute haben deren Vertreter diskutiert, ob sich all diese Entwicklungsziele überhaupt erreichen lassen, wenn ein Land politisch instabil ist. Also haben sie ein zusätzliches Ziel vorgeschlagen, das sich speziell mit Frieden und Sicherheit befasst“, sagt Analystin Fatan Aggad. Denn gerade in Afrika werde deutlich, wie eng alle Entwicklungsziele zusammenhingen: „Die Kriege haben viele Ursachen: Klimawandel, Streit um Land. Man kann sie nicht nur durch Friedensmissionen und Interventionen lösen. Man muss die Ursachen von Instabilität angehen.“
Politikberater Bakary Kante aus dem Senegal verfolgt den langwierigen Verhandlungsprozess sehr skeptisch. „Die Bürokraten in New York feilschen um jedes Komma und jeden Punkt. Dabei haben sie den Bezug zur Realität längst verloren“. Ihm geht es um einen eigenen afrikanischen Ansatz, der die Fehler der Industrie- und Schwellenländer nicht wiederholt. Afrika müsse sein bisheriges Entwicklungsmodell überdenken und neue Wege gehen. „Europa stößt an seine Grenzen, Nordamerika auch. Und wie Asien seine natürlichen Ressourcen ausbeutet, kann einem nur Angst machen“, sagt Kante.
Money, Money, Money
Und wer soll das alles bezahlen? Schon jetzt ist klar: Das Geld ist knapp, denn nur wenige Industriestaaten werden ihr Versprechen einlösen, bis Ende des Jahres 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens für staatliche Entwicklungshilfe auszugeben. Auch Deutschland dürfte noch weit davon entfernt sein: 2013 kam die Bundesrepublik gerade einmal auf 0,38 Prozent. „Viele der traditionellen Geberländer haben jetzt vor allem ihre eigenen Probleme im Sinn“, sagt Analystin Aggad und spielt auch auf die Wirtschafts- und Finanzkrise an. Afrika müsse also künftig noch mehr selbst zur Finanzierung der eigenen Entwicklung beitragen. Das bedeute vor allem: mehr Steuern eintreiben und Korruption bekämpfen.
Mehr Eigenverantwortung der afrikanischen Staaten fordert auch Salina Sanou von ACORD. „Das Problem mit den Millenniumszielen war doch, dass sie die Welt eingeteilt haben in Geber und Empfänger von Hilfe – also den Westen und die Entwicklungsländer.
Weiterlesen…