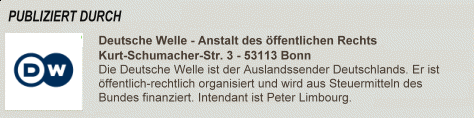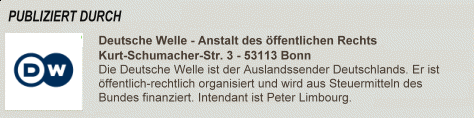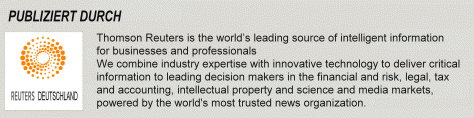(Bildquelle: DW)
Weltweit wird aufgerüstet: Das internationale Friedensforschungsinstitut SIPRI hat neue Zahlen zum Waffenhandel vorgelegt.
Trotz Krisen und Sparmaßnamen besonders in Europa sind die globalen Waffen-Ex- und Importe in den vergangenen fünf Jahren um 16 Prozent gestiegen, so der neue Bericht des Internationalen Friedensforschungsinstituts in Stockholm, SIPRI. Die USA bleiben weltweit größter Waffenexporteur und haben im selben Zeitraum die Exporte um fast ein Viertel erhöht. Doch wo früher dem Export vor allem politisch-strategische Überlegungen zu Grunde lagen, vermutet SIPRI-Autor Siemon Wezeman heute auch noch andere Motive für den steigenden Export.
„Der US-Verteidigungsetat wird zusammengestrichen und die US-Industrie schaut mehr und mehr auf die Export-Möglichkeiten. Nicht nur als einen extra Bonus, sondern als einen ernstzunehmenden Teil des Geschäfts“, so Wezemann, einer der Hauptverantwortlichen für den Bericht.
Punkte wie in einem Computerspiel
Im jährlichen SIPRI-Bericht über die globalen Waffenlieferungen wird der weltweite Handel mit größeren konventionellen Waffensystemen anhand öffentlich zugänglicher Daten analysiert. Kleingerät, Kleinwaffen und Munition gehören nicht dazu – sondern größere Waffensysteme wie Flugzeuge, Schiffe, Flugabwehrsysteme oder Panzer.
Um verschiedene Waffen gegeneinander aufrechnen zu können, werden ähnlich wie in einem Computerspiel Punkte verteilt, denn ein Flugzeugträger und ein Panzer lassen sich kaum vergleichen.
„Grundsätzlich vergeben wir Punktzahlen, die den strategischen Wert der spezifischen Waffe widerspiegeln“, so Wezeman. Somit habe man auch nicht das Problem, dass Waffenlieferungen durchaus sehr schwankende Preise aufweisen. „Dieselbe Waffe kann für ein Land doppelt so teuer sein wie für ein anderes – oder auch verschenkt werden“.
Glaubwürdige Trends
Jan Grebe vom Internationalen Konversionszentrum Bonn, BICC, schätzt die Berichte der Kollegen in Stockholm. Zwar sei die Methode, über offene Quellen zu recherchieren, nicht unumstritten. „Trotzdem geben die Zahlen die Entwicklung auf dem internationalen Waffenmarkt wieder und zeigen Trends und mögliche Gefahrenquellen sehr gut auf“, betont der Rüstungsexperte aus Bonn.
Im Bericht werden Fünf-Jahres-Zeiträume verglichen, um weitgehend kurzfristige Schwankungen auszublenden.
Russland rüstet weltweit auf
Auch im diesjährigen Bericht bestätigen sich die Trends der Vorjahre. Die USA sind auch weiterhin mit Abstand weltgrößter Waffenexporteur, doch in den vergangenen fünf Jahren hat Russland aufgeholt und nochmal 37 Prozent beim Export zugelegt.
„Nach dem Krieg in Georgien 2008 hat die russische Politik ein umfassendes Modernisierungsprogramm für die Industrie, aber vor allem auch für die Armee angestoßen“, betont Rüstungsexperte Jan Grebe vom Bonner Institut BICC.
„Inzwischen hat die russische Regierung mit erheblichen Finanzproblemen zu kämpfen, so dass diese Modernisierungsstrategie nur in Teilen umgesetzt werden kann und in vielen, vielen Bereichen wirklich stockt“, so Jan Grebe, der darin auch den Grund für den Exportvorstoß sieht. Zum einen als Kompensation für die russische Rüstungsindustrie und zum zweiten auch, um finanzielle Mittel für die Entwicklung neuer Technologien von Außen zu bekommen. Märkte, so Jan Grebe, gebe es genug, zum Beispiel in Afrika und Asien oder auch bei Verbündeten in anderen Regionen.
Discounter China
China hat mittlerweile den weltweit zweitgrößten Verteidigungsetat, nur übertroffen von den USA. Doch China rüstet nicht nur zu Hause auf: Die Exporte von konventionellen Waffensystemen sind in den vergangenen fünf Jahren um 143 Prozent gewachsen. Damit ist China heute der drittgrößte Waffenexporteur der Welt und hat die Bundesrepublik vom dritten Platz verdrängt.
„China ist eine Art Discount-Exporteur. Was man aus China kaufen kann, ist oft ein bisschen preiswerter als anderswo“, kommentiert Siemon Wezeman von SIPRI den chinesischen Exporterfolg.
Seit den 1990er Jahren habe China seine Rüstungstechnologie ausgebaut, so Wezeman. Heute sei China eben so weit, dass die Volksrepublik auch auf dem Weltmarkt verkaufen könne, auch wenn die Systeme nicht mit westlicher Technologie vergleichbar seien.
„Vermutlich spielt da auch eine Rolle, dass China, ähnlich wie Russland, etwas lockerer mit Exportgenehmigungen umgeht. Auch wenn es um Länder geht, wo europäische Länder oder die USA zögern würden und sagen, vielleicht nicht jetzt, wegen der politischen Situation im jeweiligen Land“.
„Erbstücke“ für Terrormilizen
Generell, so der SIPRI-Experte, sei dem Waffenhandel keine Grenzen gesetzt. „Alle Länder der Welt, egal wie sie sich benehmen, können Waffen kaufen“. Exportrestriktionen seien zwar ehrenwert, aber wo es Käufer gebe, gebe es auch Anbieter.
Nicht nur Länder, sondern auch Terrorgruppen wie der IS oder Boko Haram kommen immer an Waffen.
„Man muss sich immer vor Augen führen, dass Waffen sehr langlebige Güter sind, die eine Lebensdauer von zehn, 15 bis 20 Jahren haben oder länger“, betont Jan Grebe. Als Beispiel nennt er den Fall des Gaddafi-Regimes in Libyen. Danach sei im Prinzip die libysche Waffenkammer geöffnet und die Waffen sowohl in Richtung Mali als auch in den Nahen Osten und Syrien verkauft worden.
Russische Waffen für Separatisten
Eigentlich soll das internationale Waffenhandelsabkommen (Arms Trade Treaty), das am 24. Dezember 2014 in Kraft trat, helfen, den Handel mit konventionellen Waffen besser zu überwachen und kontrollieren. Russland hat den Vertrag zwar nicht unterschrieben, doch:
„Russland hat immer darauf bestanden, dass Waffenverkäufe an nicht-staatliche Akteure illegal seien. Das war auch die russische Position bei den Verhandlungen zum Waffenhandelsabkommen“, erzählt Siemon Wezemann von SIPRI. Es sei zwar schwierig nachzuweisen, dass Russland Waffen an die Separatisten in der Ukraine liefert.
„Doch manche der Waffen, die von den ukrainischen Separatisten eingesetzt wurden, sind so neu, dass sie nur aus Russland kommen können“, sagt Wezeman.
Er betont, dass das Stockholmer Friedensforschungsinstitut auch weiterhin die Spur der Waffen verfolgen wird.
Weiterlesen…
Video ansehen…